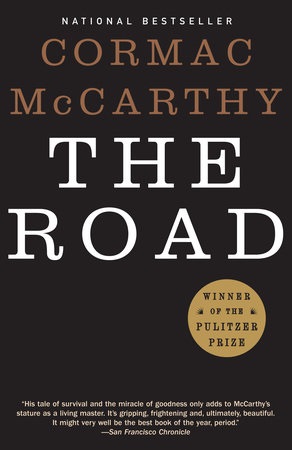Wie es werden könnte, wenn wir uns nicht ändern – Cormac McCarthys The Road rezensiert
von Walther
Cormac McCarthy, The Road, Vintage International an Imprint of Random House 2007, ISBN 978-0-307-38645-8, Paperback, 287 S., $ 7,99
Auf Deutsch erschienen als: Die Straße, übertragen von Nikolaus Stingl, Rowohlt Verlag, Hamburg 2008, ISBN: 978-3-499-24600-5, Taschenbuch, 256 S., € 12,00
Für „The Road“ erhielt Cormac McCarthy den Pulitzer-Preis des Jahres 2007 – wie der Rezensent meint, völlig zurecht. Man kann sicherlich darüber streiten, wie man geschriebene Roadmovies findet. Dieser auf das absolut wesentliche herunterreduzierte Western, der auf einer völlig zestörten Welt einen schwerstkranken Vater mit seinem kleinen Sohn jeden Augenblick ums Überleben kämpfen lässt, ist nicht nur beeindruckend; er ist im besten und schlechtesten Sinn verstörend und angsteinflößend.
Ähnlich bedrückend ist allenfalls der zweite Abschnitt von „The Wall“, die bereits besprochen wurde. Es erstaunt daher nicht, dass auch dieses Buch eine Pulitzer-Shortlist-Nominierung hatte. The Road ist in der Betrachtung der Grundfragen menschlicher Existenz noch klarer als die meisten Romane der Neuzeit, die der Rezensent gelesen und besprochen hat. Dieser Band hat das ultimativ Böse und das ultimativ Gute zum Gegenstand. Die Situation, in der sich die beiden Helden auf ihrer Suche nach anderen Guten unten den übriggebliebenen Menschen befinden, lässt ein Grau nicht zu. Es geht nur Schwarz oder Weiß.
Nun kann man der Ansicht sein, das Thema und seine Ausführung seien typisch „amerikanisch“. Formulieren wir es anders: Es erscheint fast so, als wären europäische und speziell deutschsprachige Autor*innen eine lange Zeit nicht dazu in der Lage gewesen, derartig grundsätzlich die wesentlichen Fragen menschlicher Existenz zu behandeln. Das hat sich in jüngster Zeit etwas geändert. Allerdings wird immer noch zu viel Vergangenheit bewältigt und zu wenig Zukunft bearbeitet.
Cormac McCormick schafft beides: Er entwirft eine archaische Welt mit archetypischen Protagonisten: Vater und Sohn ziehen und quälen sich durch eine tundrische Umgebung einem Ziel zu, das sie nicht zu kennen scheinen. Das Ziel schält sich aus den Ereignissen und Wechselfällen, den Kämpfen, heraus, die sie zu meistern haben. Der Vater muss den Sohn in Sicherheit bringen, zu anderen Wohlgesonnenen, an den ganzen Desperados vorbei, die nichts Gutes wollen und durch die böse Tat eigentlich nur eines wollen: überleben. Wer kann ihnen das vorhalten. Der Vater tut es nicht, der Sohn lernt erst, wie diese Welt läuft.
Dass sie es am Ende wohl schaffen werden, der Vater sein Ziel erreicht und der Sohn in Sicherheit gebracht ist, kann vorausgesetzt werden. Jede andere Auflösung wäre noch trostloser als die Weltzeit, in der der Roman spielt. Wie es dahin kommt, bleibt dem Leser des Taschenbuchs vorbehalten, das am Anfang in seiner gnadenlos skelettierten Lakonie zäh anmutet, aber nach und nach einen Sog entwickelt, der dazu führt, dass man das Buch kaum mehr aus der Hand zu legen im Stande ist.